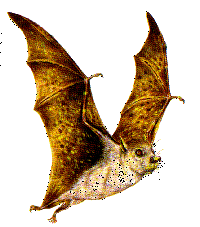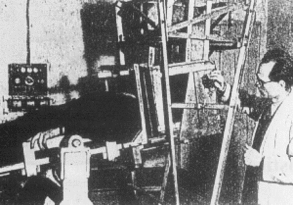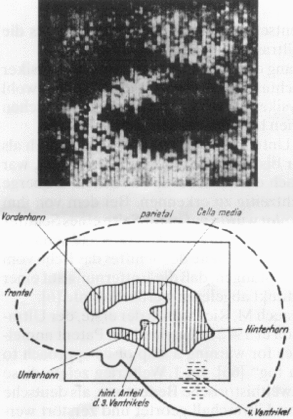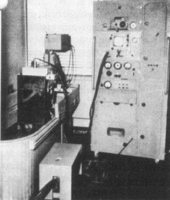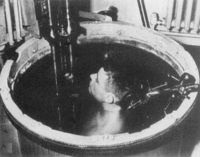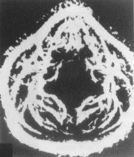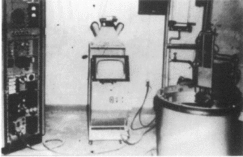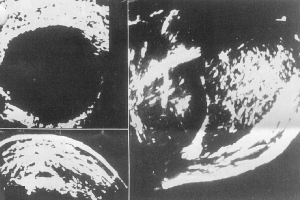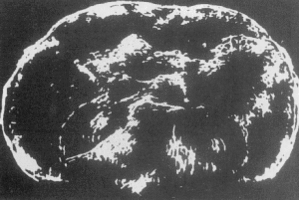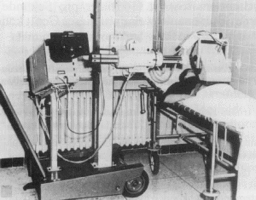Geschichte des diagnostischen Ultraschalls
Ultraschallmuseum
Das Ultraschallmuseum wurde 1993 als eigenständiger Verein gegründet.
Auf der Website finden Sie Angaben zur Geschichte des Museums sowie zur Organisation und Struktur. Insbesondere können Sie sich Exponate anschauen, Poster herunterladen und Veröffentlichungen bis 1975 über Ultraschall finden. Auch Wanderausstellungen sind möglich.
Geschichte der diagnostischen Sonographie
Ultraschall gibt es seit einigen tausend Jahren in der Natur, nachdem es Tiere in der Evolutionsgeschichte gelernt haben, sich im Raum mit Ultraschall zu orientieren. Als populärstes Beispiel dient hier sicherlich die Fledermaus. Wie aber gelang es dem Menschen nachzuweisen, dass ein im ursprünglichen Wortsinn übersinnliches Phänomen wie der ja nicht hörbare Ultraschall überhaupt existiert? Wie immer bei bedeutenden Forschungsergebnissen lautet die Antwort: aus der Kombination von exakter Beobachtung der in der Natur vorkommenden Phänomene, der logischen Verknüpfung der dabei gemachten Erfahrungen und einer vorurteilslosen Versuchsanordnung. Ohne Risiken war und ist die Fledermausforschung übrigens nicht. Zum einen natürlich, wie noch ausgeführt wird, für die Forschungsobjekte, also die Fledermäuse selbst. Zum anderen auch für die Forscher. In der Deutschen Medizinischen Wochenschrift wurde beispielsweise berichtet, dass sich eine Forschungsgruppe beim Besuch einer von Fledermäusen bewohnten Höhle auf Kuba mit Histoplasmose infiziert hatte, weil die Teilnehmer kurzzeitig die Atemmasken abgenommen und dann den über den Kot der Tiere ausgeschiedenen Erreger inhaliert hatten.
Großer Röhrennasenflughund
Schon immer verblüffte die Mühelosigkeit, mit der Fledermäuse selbst in dunkler Nacht auf Beutefang gingen und dabei im schnellen Flug Hindernissen mit Leichtigkeit auszuweichen vermochten. Sollte die Fledermaus etwa, wie von einigen anderen Tierarten bekannt, sich auch bei Nacht an kleinsten Helligkeitsunterschieden orientieren können?
Der Ahnherr der Fledermausforschung ist eine Persönlichkeit mit dem klangvollen Namen Lazzaro Spalanzani, am Ende des 18. Jahrhunderts Bischof von Pavia und in dieser Funktion keineswegs ausgelastet. Er blendete 1793 Fledermäuse, um festzustellen, wie sie sich, ihres Augenlichtes beraubt, im Raum bewegten. Die nicht geblendeten Fledermäuse flogen problemlos zwischen senkrecht in einem Raum aufgespannten Wollfäden hindurch. Die wirkliche Sensation bestand jedoch in Spalanzanis Entdeckung, dass auch die blinden Fledermäuse unbehelligt passierten. Als nächsten Schritt führte Charles Jurin, ein Genfer Naturforscher und Physiologe, folgendes Experiment durch: Er verstopfte Fledermäusen die Ohren, blendete sie aber nicht. Es stellte sich nun heraus, dass die zwar sehenden, jedoch ihres Gehörs beraubten Fledermäuse ihren Orientierungssinn verloren hatten und nicht mehr in der Lage waren, Hindernissen auszuweichen. Hiermit war man der Wahrheit schon ziemlich nahe gekommen, doch zog man die falschen Schlüsse: Man folgerte nämlich, daß alles auf den Tastsinn der Fledermäuse zurückzuführen sein müsse, wenn es, wie bewiesen, das Sehvermögen nicht sein könne.
Eine der mondänsten Erscheinungen des damaligen Wissenschaftsbetriebs war der französische Baron Georges Baron de Cuvier (1769 - 1832). De Cuvier stellte die These auf, dass Fledermäuse an ihren Flügeln den Luftwiderstand spüren, der bei Annäherung an ein Hindernis entstehe.
Zweifellos wurde hier nicht nur eine einleuchtende, sondern auch elegante Erklärung für das Flugverhalten der Fledermäuse präsentiert, die von der wissenschaftlichen Welt für die nächsten hundert Jahre auch akzeptiert wurde. Falsch war sie trotzdem. 1864 formulierte Alfred Brehm sehr vorsichtig: "Der Sinn des Gefühls mag nun erstentheils in der Flatterhaut liegen, wenigstens scheint dies aus allen Beobachtungen hervorzugehen". Und weiter: "Weit ausgebildeter aber als dieser Sinn sind Geruch und Gehör". Und obwohl Brehm den letzten Schritt zur Erkenntnis nicht tat, so stellte er doch immerhin fest: "Es ist unzweifelhaft, daß die Fledermaus vorbeifliegende Kerbtiere schon in ziemlicher Entfernung hört und durch ihr scharfes Gehör wesentlich in ihrem Fluge geleitet wird", um kühl fortzufahren: "Schneidet man die blattartigen Ansätze oder die Ohrlappen und Ohrdeckel ab, so werden alle Flattertiere in ihrem Flug ganz irre und stossen überall an".
Zu Beginn des letzen Jahrhunderts war man in der Forschung eigentlich noch nicht über Spalanzani hinausgekommen. Neue Experimente - natürlich wieder zu Lasten der Fledermäuse - waren erforderlich, um zu beweisen, dass de Cuvier sich geirrt hatte. Man anästhesierte die Flügel und damit den Tastsinn der Tiere, ohne dass dies zu einer merklichen Beeinträchtigung des Flugverhaltens führte. Verstopfte man dagegen die Ohren der Fledermäuse mit Wachs, gerieten sie prompt ins Taumeln. Wer sandte nun die Töne aus, die die Fledermaus so offensichtlich zur Orientierung während ihres Fluges brauchte? Offensichtlich weder Spalanzanis Fäden noch andere in der Natur vorkommende tote Gegenstände. Die logische Antwort: nur sie selbst konnte es sein.
Längst vergessen ist der Name des holländischen Forschers Dijkgraaf. Dieser setzte seinen Fledermäusen eine papierne Maulkappe auf, die sich öffnen und schließen ließ. Bei geöffneter Klappe flogen die Tiere perfekt, bei geschlossener Klappe gerieten sie ins Schlingern. Damit war man bei der Wahrheit angekommen. Akustik hieß das Zauberwort, auf das die Menschen allein deshalb so lange nicht kamen, weil die von der Fledermaus ausgestoßenen Töne für das menschliche Ohr viel zu hoch sind. Das Weltbild der Fledermaus ist ein Hörbild.
All diese Studien wurden von einer Koryphäe der Fledermausforschung, dem Zoologen Martin Eisentraut, in seinem Werk "Aus dem Leben der Fledermäuse und Flughunde" vorgestellt. Er ergänzte die bestehenden Erkenntnisse um das entscheidende Experiment, das die Existenz von Ultraschallwellen bewies: "Zum Abschluß all dieser glänzenden Versuche gelang schließlich auch der bisher noch fehlende Nachweis, daß Fledermäuse die hochfrequenten Töne wirklich hören können und imstande sind, die Richtung des aufgenommenen Schalls festzustellen. Ein Abendsegler wurde auf einem künstlich hervorgebrachten Ultraton von 40 Kilohertz in der Weise dressiert, daß dem Tier jedesmal bei einem Tonsignal ein Mehlwurm gereicht wurde. Sehr bald hatte die Fledermaus beides in Verbindung gebracht und reagierte nun bei Auslösung des Tones mit einem Heben des Kopfes und später sogar mit einem Anfliegen der Schallquelle".
Des Rätsels Lösung war damit gefunden. In diesem Zusammenhang ist auf das Ohr der Fledermaus zu verweisen, das selbst dem ungeübten Beobachter als auffallend groß erscheint.
Braunes Langohr
Diese überdimensionierten Ohren dienen den Fledermäusen dazu, die Echos der von ihnen ausgestoßenen Orientierungssignale aufzufangen. Ob die Signale durch das Maul oder die Nase aussgestoßen werden, hängt davon ab, um welche von zwei großen Gruppen von Fledermäusen es sich handelt, um Hufeisennasen oder Glattnasen.
Kleine Hufeisennase
Die Hufeisennasen, wie beispielsweise das auch hierzulande vorkommende Große Mausohr (Myotis myotis), tragen einen bemerkenswerten Nasenaufsatz, der den Glattnasen fehlt. Der Nasenaufsatz erlaubt ihnen, die Töne zielgerichtet zu senden und Gegenstände - ob Hindernisse oder Beute - auf größere Entfernung anzupeilen.
Fischfressende Glattnase
Objekte, die acht Meter von ihr entfernt sind, kann die Hufeisennase noch orten. Dabei fliegen die Hufeisennasen mit geschlossenem Maul und stoßen durch die Nase hohe, lange Pfeiftöne aus. Anders die Glattnasen: ihr Ton ist explosionsartig kurz und reicht nur für kurze Entfernungen von etwa einem Meter. Sie erzeugen den Ton mit dem Maul. Die von den Ohrmuscheln eingefangenen Echos werden über die Gehörknöchelchenkette zum Innenohr mit der Schnecke und von dort zum Hörnerv übertragen. Bereits im Innenohr weisen Fledermäuse schon einen ausgeprägten Hörfilter auf, der ihnen erlaubt, in ihrem Ortungssystem mit einer akustischen Trennschärfe zu arbeiten, die bis zu fünfzigmal höher ist als bei anderen Säugetieren. Dies ist auch notwendig, da Fledermäuse, wenn sie beispielsweise im Blatttwerk eines Baumes nach Insekten jagen, vielfältige Signale, sowohl von den Beutetieren, als auch von den Zweigen und Blättern empfangen, die auseinandergehalten werden müssen.
Von den Fledermäusen bis zum heutigen Stand der diagnostischen Sonographie war es jedoch ein weiter Weg. Da der Mensch bekanntermaßen von Natur aus nicht über die Fähigkeit zur Erzeugung von Ultraschall verfügt, macht er sich den sogenannten piezoelektrischen Effekt zunutze, der 1880 von Pierre Curie, Chemieprofessor an der Sorbonne in Paris, und seiner Gattin und Nachfolgerin Marie Curie an Quarzen entdeckt wurde.
Als einer der ersten beschäftigte sich der deutsche Physiker A. Behm mit dem Ultraschall. Der tragische Untergang der Titanic 1912 war für ihn Anlass, nach einer Methode zu suchen, Eisberge unter Wasser rechtzeitig zu erkennen. Bei dem von ihm entwickelten Echolot wurde auf einer Seite eines Schiffes durch eine Lotpatrone das notwendige Knallsignal erzeugt und auf der anderen Seite des Schiffes das Echo vom Meeresgrund so empfangen, sodass die Entfernung auf einer Skala in Metern direkt abgelesen werden konnte.
Im ersten Weltkrieg zeigte der Ultraschall seine welthistorische Bedeutung, als deutsche Unterseeboote mit Ultraschall geortet und anschließend zerstört werden konnten (Langevin und Chilkowsky 1916).
In den 1930er Jahren wurde in Europa und den USA die zerstörungsfreie Materialprüfung die zweite Anwendungsform des Ultraschalls. In Japan wurden Ultraschallgeräte zur Entdeckung von Fischschwärmen genutzt. In dieser Zeit erfolgte auch eine euphorische, unkritische Anwendung des Ultraschalls zur Behandlung verschiedener Erkrankungen bis hin zu dem Versuch, Tumoren zu zerstören. So wurde in den Verhandlungsberichten der nordwestdeutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1947 festgehalten: "Die selektive Wirkung der Ultraschallwellen auf Karzinomzellen ist größer als bei Röntgen- und Radiumstrahlen".
Ultraschall kann Papierblätter entflammen, Gase durch entsprechende Sirenen entstäuben, die Struktur makromolekularer Stoffe verändern und sonst nicht mischbare Flüssigkeiten wie Wasser und Quecksilber oder Wasser und Öl, emulgieren. Weniger beliebt ist die Verwendung von Ultraschall unter gleichzeitiger Ausnutzung des Doppler-Effekts in Radar-Fallen.
Der östereichische Neurologe K. Th. Dussik war der erste Mediziner, der den Ultraschall zu diagnostischen Zwecken nutzbar machte. 1938 publizierte er zusammen mit seinem Bruder seine Methode der Hyperphonographie zur Beurteilung der Gehirnventrikel. Dabei erwies sich einmal mehr, dass die brillianteste Idee nichts nutzt, wenn ihre Anwendung am falschen Objekt erfolgt. Dussik bestand nämlich darauf, seine Methode am menschlichen Gehirn auszuprobieren. Von allen Organen war nun das Gehirn am wenigsten geeignet, da es vollständig vom Schädelknochen umgeben wird, der zumindest mit damaligen Methoden nur sehr unvollständig vom Ultraschall zu durchdringen war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die durch den Krieg weiterentwickelten Sonar- und Radarsysteme Ausgangspunkte für die weitere Entwicklung der Sonographie. 1950 entwickelten Howry und Bliss den ersten Wasserbadscanner. Als Wasserbad diente zunächst ein Waschbottich, später eine Viehtränke, sodass dieses Gerät als der "cattle tank scanner" in die Geschichte einging. Der Patient bzw. das zu untersuchende Organ tauchte in dieses Wasserbad ein, und der Schallkopf fuhr linear motorgesteuert auf einer Hozschiene entlang der Tränke.
1954 wurde der erste zweidimensionale "compound-scanner" vorgestellt. Als Wasserbehälter diente nun ein Bombenauswurfschacht von der B29, entsprechend wurde dieses Gerät als "gun turret scanner" bezeichnet. Der Schallkopf fuhr automatisch zirkulär im Wasserbad und beschallte so den Patienten aus allen Richtungen. Gleichzeitig wurde der Schallkopf während der Rundumbewegung auch in einem bestimmten Winkel automatisch hin und her bewegt, daher die Bezeichnung "compound".
Hierbei handelte es sich noch um sogenannte bistabile, also echte Schwarz-Weiß-Bilder, eine Umsetzung der empfangenen Echostärke in verschiede helle Bildpunkte war noch nicht möglich. Bei den bisherigen Geräten lag der Patient im Wasserbad und musste zum Teil mit Bleiplatten beschwert werden. Geholfen hat dies nicht viel, zudem war die Methode nur für Patienten mit robuster Konstitution geeignet.
Um auch kranke Patienten untersuchen zu können, wurde dann 1956 der nächste Scanner entwickelt - der sogenannte "half pan scanner". Es handelte sich um ein semizirkuläres Becken, bei dem in der geraden Seite eine Einbuchtung zum Wasser hin bestand, die mit einer Plastikmembran versehen war. Der Patient saß auf einem modfizierten Zahnarztstuhl und wurde an dieser Ausbuchtung befestigt, nachdem er mit Autoöl eingeschmiert worden war. Der Schallkopf fuhr im Wasserbad automatisch 180 Grad in der Compound-Technik. Um mehrere Schnittebenen zu erhalten, wurde der Zahnarztstuhl herauf- und heruntergefahren, da die Schallkopfanordnung starr war.
Der nächste faszinierende Höhepunkt der Ultraschallgeschichte kam mit dem Gynäkologen I. Donald, der 1957 den ersten Kontakt-compound-scanner konstruierte. Jetzt war es nicht mehr nötig, den Patienten in ein Wasserbad zu tauchen, sondern der Schallkopf wurde direkt auf die Haut aufgesetzt und von Hand bewegt. Der Weg war nun frei für eine breite Anwendung der Ultraschallmethode in der Medizin, auch wenn I. Donald selbst seine Ergebnisse noch sehr kritisch beurteilte: ".... but our findings are still of more academic interest than practical importance, and we do not feel that our clinical judgement should be influenced by our ultrasonic findings".
Die neuere Geschichte beginnt mit den Real-time-Geräten. Das erste Echtzeitgerät, der sogenannte "schnelle B-Scan" wurde 1956 in den Siemenswerken in Erlangen vorgestellt. Das "Vidoson" war ein mechanischer Parallelscanner, mit dem ein 14 cm großer Körperausschnitt in Echtzeit mit 16 Bildern/Sekunde untersucht werden konnte. Konzipiert war dieses Gerät für das Mammakarzinomscreening. Sehr schnell jedoch wurde es von Internisten und Radiologen entdeckt und zur Abdomensonographie genutzt.
Da zur Bedienung der Geräte ein großes physikalisches Wissen und ein immenser Zeitaufwand notwendig war, ist es verständlich, daß diese Methode nur von einem kleinen Kreis von Enthusiasten angewendet wurde. So verwundert nicht ein Ausspruch aus dem Jahre 1974: "Mit dem momentanen Stand der Technik ist Ultraschall mehr eine Kunst als eine Wissenschaft".
1972 stellten die Australier Kossoff und Garrett die Grauabstufung des B-Bildes, die sogenannte Grey-Scale-Technik vor. Die Ära der Wasserbaduntersuchungen war vorbei und es standen Kontakt-compound-Scanner zur Verfügung. Als 1977 der erste serienreife Sektorscanner, die Combison 100, auf den Markt kam, änderte sich die Situation für die Ultraschaller zunächst langsam, dann schlagartig. Ab Anfang der 1980er Jahre kam dann mit den Geräten der nächsten Generation der gewaltige Durchbruch. Die Sonographie fand in vielen Fachbereichen Einzug und ist heute aus der klinischen Routine nicht mehr wegzudenken.
Wie die Fledermäuse einen Dachboden oder eine Höhle brauchen, so benötigen die Radiologen die DRG und die deutschen "Schaller" die DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin). Daher der Appell an alle sonographisch Tätigen: unbedingt eintreten!
Verfasser
Prof. Dr. H. Strunk
Dr. B. Frentzel-Beyme
Dr. G. Stuckmann